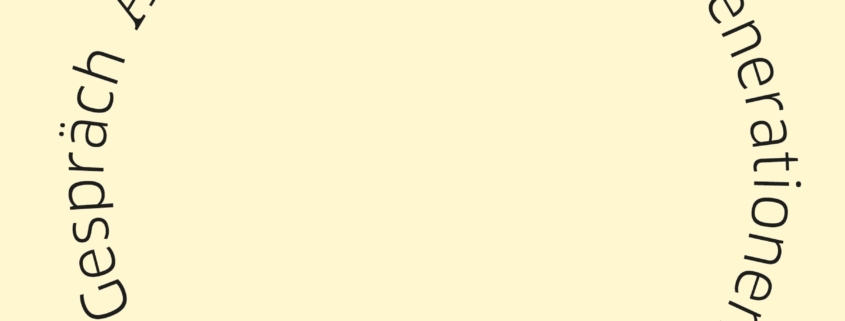
Sie waren Redakteur:innen der ersten Stunde: Natalie Eichwald, Michael Schönball, Phillip Geisen und Susanne Grimbacher. Die neue Generation hat sie zu ihren Anfängen beim berufen-Magazin und zu ihrer heutigen Tätigkeit und wie diese jeweils mit Berufung verbunden sind, befragt. Die vier erzählen von Erinnerungen, Lernerfahrungen und neuen Ideen und Wünschen für das Magazin.
Natalie Eichwald (27)
studierte katholische Theologie und Latein auf Lehramt in Tübingen und stieg 2012 als Redakteurin beim berufen-Magazin ein. Heute arbeitet sie als Lehrerin in Freiberg am Neckar.
Natalie, du bist jetzt Lehrerin in Freiberg am Neckar. Spielt in deinem Schulalltag „Berufung“ eine Rolle?
Ja, zum einen fühle ich mich natürlich berufen, Lehrerin zu sein und brenne dafür. Zum anderen geht es im Religionsunterricht immer wieder um das Thema Berufung. Kürzlich hatten meine Schüler:innen ein Sozialpraktikum und haben dabei wahrscheinlich mehr gelernt als das ganze Schuljahr über. Begegnungslernen zu ermöglichen, Schüler:innen mit verschiedenen Berufungen in Kontakt treten zu lassen und selbst AnsprechspartnerIn und Vorbild zu sein, ist unglaublich wichtig beim Thema Berufung.
Wenn du auf deine Studienzeit zurückblickst, vermisst du etwas?
In Tübingen kann man seinen Glauben mit so wunderbar vielen jungen Menschen teilen und leben. Es gibt viel Input für die eigene Spiritualität und einen vielfältigen Austausch mit Gleichaltrigen über solche Fragen.
Ab wann warst du berufen-Redakteurin? Wie hast du die Entstehungsphase erlebt? Ich war nicht ganz von Anfang an dabei, aber recht schnell. Es war spannend zu sehen, wie sich die Redaktionssitzungen verändert haben. Die gingen anfangs noch deutlich länger. Wir hatten noch ganze Texte gemeinsam gelesen, was total wertvoll war, aber irgendwann wurden wir geübter oder professioneller.
Hast du eine Lieblingserinnerung aus deiner Berufen-Zeit?
Mir fallen so viele schöne Szenen ein. Einmal waren wir bei Stuttgart 21 und haben den Baustellenseelsorger interviewt, da haben wir Kirche in einer ganz anderen Atmosphäre erlebt. Ich erinnere mich auch noch gut an die Begegnung mit einer Krankenhausseelsorgerin. Dieser Bericht hat mich sogar einmal in der Unterrichtsvorbereitung begleitet, um SchülerInnen verschiedene Personen im kirchlichen Bereich zu zeigen.
Was schöpfst du heute aus deiner Zeit als berufen-Redakteurin?
Die Wichtigkeit von Begegnungslernen. Ich habe viel gelernt durch die einzelnen Gespräche und von den Personen, die einem viel mehr geben, als wenn man nur ein Buch lesen würde. Und dementsprechend auch der Vorsatz, Menschen einzuladen in den Religionsunterricht, um solche Begegnungen für SchülerInnen zu ermöglichen. Außerdem habe ich meinen letzten Artikel über das spirituelle Zentrum Station S geschrieben und war dort danach bei einigen Veranstaltungen. So hat berufen also auch Spuren hinterlassen.
Was wünschst du dem Magazin für die kommenden Jahre?
Viele Redakteur:innen, die mit Motivation und Begeisterung dabei sind. Offenheit für die Vielseitigkeit an Themen und besonders eine große LeserInnenschaft, sodass berufen viele inspiriert, den Blick über den eigenen Wirkungskreis hinaus zu wagen.
Michael Schönball (31)
studierte in Tübingen und Heiligenkreuz katholische Theologie und war von der ersten Stunde an beim berufen-Magazin als Redakteur dabei. Aktuell ist er Vikar in Ludwigsburg.
Michael, du bist gerade Vikar in Ludwigsburg, vermisst du denn deine Studienzeit?
Ich muss sagen, ich bin sehr gerne Vikar und trauere dieser Zeit also nicht nach. Aber ich schätze an damals sehr die Gemeinschaft und die Blase von Theolog:innen – das ist ein riesiges Privileg. Außerdem natürlich die große Freiheit und den Raum, um sich selbst finden zu können.
Warst du berufen-Redakteur erster Stunde?
Ich denke, ja. Alina Oehler, die Koordinatorin und spätere Chefredakteurin, und ich haben damals für das Vorgänger-Magazin von berufen, den „Wegbereiter“, ein Statement über das Salvatorkolleg in Bad Wurzach geschrieben. Irgendwann wurde ich dann zu einer Sitzung eingeladen, bei der es darum ging, das jetzige berufen-Heft zu kreieren.
Wie hast du diese Anfangszeit wahrgenommen?
Wirklich cool war am Anfang eine Sitzung, ich erinnere mich noch wie heute, bei der wir überlegt haben, in welchen Formaten wir Berufungen darstellen können. Dabei haben wir wahnsinnig viel gelernt und so sind die Rubriken entstanden: Reportagen, sieben Fragen, Heiligenbiografien … Dieser Zauber des Anfangs war schon etwas Besonderes. Zu überlegen, wie wir Berufung, eine unglaublich schöne Sache, so darstellen, dass es jüngere Menschen positiv erreicht.
Hast du eine Lieblingserinnerung aus deiner Redaktionszeit?
Viele Dinge waren ein Highlight, aber auf ihre eigene Art und Weise. Wir stellten damals zum Beispiel die „Sieben Fragen“ an Tobias Freff, den damaligen Bischofssekretär, und haben gemeinsam eineinhalb Stunden nur gelacht. Oder die Reportage über Philipp Sauter, ein junger Salvatorianer aus München mit einer krassen Lebensgeschichte. Danach dachte ich damals: Wow – Gott ist groß. Was kann Gott in einem Leben alles machen? Unglaublich.
Und eine Lernerfahrung?
Aus dieser Anfangszeit habe ich ein „Out-of-the-box“-Denken, also den Blick über den Tellerrand, mitgenommen. Dass man sich zutraut, beispielsweise in einem Gemeindeblatt, mal wirklich kreative Sachen zu machen. Und das klingt vielleicht langweilig, aber einfach die Tatsache, dass man beim Magazin mitgearbeitet hat. Das bringt viel und man schaut sich Zeitschriften plötzlich mit anderen Augen an.
Welche Wünsche möchtest du dem Magazin für die kommenden Jahre mitgeben?
Ich wünsche dem Magazin einen positiven Blick auf die Berufung zum „normalen“ pastoralen Dienst vor Ort – der wird nämlich unterschätzt. Das berufen-Magazin sollte kein Hochglanzmagazin sein, sondern eins, das Berufungen in ihrer Schönheit darstellt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht als „besonders vorzeigbar“ erscheinen. Außerdem gute und von Berufungen begeisterte Mitarbeiter:innen. Und eine tüchtige Portion Heiligen Geist, der immer neu Freude an Berufung schenkt.
TEXT: FRANZISKA MOOSMANN (24)
Philipp Geisen (29)
hat in Tübingen Theologie studiert und während dieser Zeit beim berufen-Magazin mitgeschrieben. Jetzt arbeitet er als Klinikseelsorger in Berlin-Neukölln und macht parallel seinen Masterabschluss in Psychologie.
Was hat dich bewogen, bei berufen mitzumachen?
Ich wurde damals angefragt und habe dann die Gelegenheit wahrgenommen, einen Einblick in das journalistische Arbeiten zu gewinnen. Wir haben damals z.B. das Layout und den Redaktionsprozess umgestellt und zu unseren Artikeln haben wir hilfreiches Feedback bekommen, das hat sich also gelohnt. Andererseits hat mich gereizt, mit Menschen über ihren Glaubensweg ins Gespräch zu kommen. Oft kannte ich die Leute vorher noch nicht, denn ich habe eher mein Interesse an Berufsfeldern wie der Krankenhaus- oder Gefängnisseelsorge eingebracht. Und dort arbeite ich jetzt tatsächlich auch.
Wie kamst du zu deinem Beruf als Klinikseelsorger?
Schon während dem Studium hatte ich eine gewisse Affinität zur kategorialen Seelsorge und habe in dieser Zeit diverse Praktika in einer JVA, im Vinzenz von Paul Hospital in Rottweil und in der Behindertenhilfe gemacht. Da ich schon in die Berufspraxis einsteigen wollte, während ich noch meinen Psycho- logie-Master in Berlin abschließe, habe ich mich dort umgesehen und eher zufällig entdeckt, dass eine Stelle als Klinikseelsorger frei war. Das war nicht von langer Hand geplant, aber hat sich perfekt gefügt.
Es reizt mich sehr, in diesem Schnittbereich von Psychologie und Seelsorge Gemeinsamkeiten, Unterschiede, gegenseitiges Lernpotential und die Stärken der jeweiligen Profession zu entdecken.
Jetzt bist du selbst auf der anderen Seite des Mikrofons und kannst die klassische Frage beantworten: Was bedeutet „berufen“ in deinem Leben oder Arbeitskontext?
Das ist für mich der Wunsch, Menschen in existenziellen Situationen zu begleiten, falls sie dies wollen, und dazu gehört auch mein Glaube, in diesen Menschen Christus begegnen zu können. Berufung prägt also ganz wesentlich meine Haltung, mit der ich in die Arbeit gehe. Der Glaube und existenzielle Fragen werden allerdings bei meiner Arbeit nicht zwangsläufig zum expliziten Thema, denn da richte ich mich stark nach den Bedürfnissen der Menschen, gemäß der jesuanischen Frage: Was willst du, dass ich dir tue? Manchmal ist das einfach ein ablenkendes Gespräch über ein Thema, das nichts mit Krankheit etc. zu tun hat und manchmal ist es auch ein gemeinsames Gebet. Das ist sehr unterschiedlich, eben so, wie die Leute und ihre Situationen unterschiedlich sind. Dazu muss man sagen, dass viele Menschen keinen expliziten Glaubenshintergrund mitbringen und dennoch passiert es mir erstaunlich selten, dass das Angebot nicht angenommen wird, weil ich katholischer Seelsorger bin.
Susanne Grimbacher (30)
studierte in Tübingen Theologie und Medienwissenschaften und war seit der ersten Ausgabe bei berufen dabei bis zu ihrem Abschluss 2017. Nach ihrer pastoralen Ausbildung hat sie bei der Projektstelle „Junge Erwachsene“ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart angefangen.
Was kannst du über die Anfänge des Magazins berichten?
Es war für mich wirklich spannend, den Entstehungsprozess mitzugestalten, denn ich habe ja parallel Medienwissenschaften studiert und mag journalistische Geschichten einfach. In der Praxis dann bei einem neuen Magazin mitzumachen war eine super Gelegenheit. Wir haben von Grund auf angefangen, Rubriken überlegt, Layout, Format … einfach alles, es gab noch nichts, worauf wir hätten aufbauen können. Und einiges hat sich bis heute durchgezogen, z.B. die „7 Fragen an“, oder dass es immer ein Porträt und eine Reportage gibt.
Wen würdest du gerne interviewen, wenn du noch Redakteurin wärst?
Wenn ich so brainstorme, fallen mir einige Personen ein. Zum Beispiel Adelheid Bläsi aus der Seelsorgeeinheit Iller-Weihung, bei der ich mein Gemeindepraktikum gemacht habe und die mich motiviert hat, diesen Berufsweg einzuschlagen. Bei ihr nahm ich wahr, dass sie wenig in alte Muster verfällt, sondern sich immer wieder neu mit dem befasst, was gerade dran ist … Das fand ich sehr inspirierend. Auch Susanne Walter, die ich bei meiner Ausbildung kennengelernt habe, hat so eine Art, voller Vitalität und Ideen, wie man die Kirche voranbringen könnte, die ich sehr schätze. Eine richtige Powerfrau ist Alexandra Stork, die zwar keine Pastorale ist, aber die Caritas in der Region Ulm-Alb-Donau leitet und starke Visionen hat, wie eine Kirche der Zukunft aussehen kann. Oder auch Pfarrer Stefan Spitznagel, der offen mit seiner Homosexualität umgeht und dessen Erfahrungen ich gerne mehr Raum geben würde. Denn die Realität im Bereich der pastoralen Berufe sollte man nicht nur hetero-normativ denken und darstellen. Kirche und ihre Berufe sind vielfältig, weil die Menschen vielfältig sind.
Du bist 2020 beauftragt worden, was bedeutet berufen für dich als Pastorale?
Ganz allgemein heißt es im Beauftragungstext: „Ich bin bereit, Gott und den Menschen zu dienen“. Und das bedeutet für mich, zuzuhören, was die Menschen unserer Zeit beschäftigt, für sie da zu sein und das in der Welt zu leben, was ich von Gott erkannt habe. In meinem konkreten Arbeitsalltag bei der Projektstelle „Junge Erwachsene“ bin ich auch bewusst Pastorale in einem säkularen Kontext, das heißt für mich: ansprechbar zu sein für Leute, die sonst nie ins Pfarrbüro oder mit der Seelsorge in Kontakt kämen. Ich hoffe, dass ich als Mensch, der von der frohen Botschaft lebt, ein anderes Bild von Kirche aufzeigen kann, jenseits der Skandale und Probleme der Institution Kirche. Aber ganz wichtig ist dabei, Kirche für Menschen zu sein und sie nicht irgendwie überzeugen und „reinholen“ zu wollen. Diese Berufung hin zu den Menschen in kirchenfernen Kontexten ist wichtig, das merke ich, und darum bin ich super gerne Seelsorgerin.
TEXT: VALERIE STENZEL (23)



